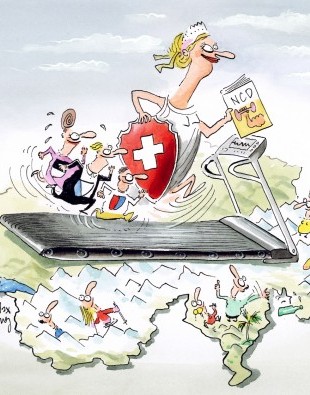Viele Programmziele erreicht – gemischte Bilanz auf politischer Ebene
Apr. 2017Ende der Nationalen Präventionsprogramme
Interview mit Andreas Balthasar. Andreas Balthasar hat die Programme Alkohol, Tabak, Ernährung und Bewegung und das Massnahmenpaket Drogen nach deren erster Laufzeit evaluiert. Wir wollten von ihm wissen, wie sein Gesamtrückblick auf die Programme aussieht, wo er deren besondere Erfolge ausmacht, was bei der Gestaltung von Programmzielen zu berücksichtigen ist und welches die Herausforderungen der künftigen Präventionsprogramme sind.
spectra: Welche Bilanz ziehen Sie aus den acht Jahren Laufzeit der Programme?
Prof. Andreas Balthasar: Eine gemischte Bilanz. Grundsätzlich haben sich die Programme positiv entwickelt. Das Wichtigste ist sicher, dass die Stakeholder, die NGOs und die Verwaltung, zusammen wichtige Schritte hin zu einer gemeinsamen Zielerreichung unternommen haben. Die Evaluationen haben gezeigt, dass die definierten Outcome- und Outputziele oft erreicht wurden. Durchzogen ist die Bilanz auf politischer Ebene. Die Programme haben zwar viel gebracht hinsichtlich der Stärkung bestehender und neuer Angebote. Auch einige institutionelle Veränderungen wurden erreicht, denken wir nur an den Passivrauchschutz. Doch die Umsetzung ist durch die politische Dynamik gehemmt worden und gerade im Alkoholbereich sind wieder Rückschritte feststellbar. So ist die geplante Totalrevision des Alkoholgesetzes, welche strukturelle Präventionsmassnahmen enthalten hätte, aufgrund unüberbrückbarer Differenzen gescheitert. So viel zu einer generellen Bilanz.
Der Blick auf die einzelnen Programme zeigt, dass die einen eher vorangekommen sind als die anderen. Im Bereich Drogen hat sich die Problemsituation zum Teil verändert, neue Themen sind hinzugekommen. Die Präventionsakteure wissen heute aber relativ gut damit umzugehen. Beim Tabak schränkt das Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen den Konsum in wichtigen Bereichen erfolgreich ein. Es hat aber gleichzeitig dazu geführt, dass an anderen Orten gar nichts mehr ging. In Sachen Alkohol etwa ist sehr wenig passiert. Das liegt sicher auch am schwierigen Umfeld. Bei den Themen Ernährung und Bewegung sind gute Fortschritte erzielt worden, was etwa die Zusammenarbeit mit den Kantonen, mit der Industrie oder mit anderen Bundesämtern betrifft. Auch zeigen die Indikatoren, dass sich das Problem Übergewicht bei Kindern etwas entschärft hat.
Welche Programmmassnahmen haben sich besonders bewährt und welche sind in Bezug auf die Weiterentwicklung neuer Strategien wichtig?
Bewährt haben sich Massnahmen, die zusammen mit der jeweiligen Zielgruppe entwickelt wurden. Wenn also mit Hausärzten/-innen ein Präventionsprogramm entwickelt wird, dann stehen die Chancen gut, dass es von der Mehrzahl der Hausärzteschaft akzeptiert wird und Wirkung erzielen kann. Erfolgversprechend sind auch Peergruppen-Ansätze, das heisst etwa die Programmentwicklung unter Einbezug von Schülerinnen und Schülern oder Jugendlichen, die zugleich als Mittler einsetzbar sind. Das sind aufwendige Prozesse, aber Ansätze, die erfolgversprechend sind.
Wichtig ist – und das hat die NCD-Strategie (NCD = non-communicable diseases; nichtübertragbare Krankheiten) ja vor – mit den Präventionsanliegen in die bestehenden Organisationen und Institutionen hineinzukommen, beispielsweise in die medizinische Grundversorgung und in die Spitäler.
Für das BAG gilt primär: zuhören, auf die Bedürfnisse eingehen, aber auf der anderen Seite durchaus auch proaktiv neue Themen aufnehmen und etwas fordern. Denn die Kantone haben ganz andere Themen und Prioritäten als die Prävention. Im Fokus der kantonalen Gesundheitspolitik stehen die Spitalfinanzierung und die flächendeckende Gesundheitsversorgung, das heisst auch, in den Regionen sollen genügend Hausärzte/-innen verfügbar sein. Der Bund muss die kantonalen Akteure unterstützen, die in der Prävention aktiv sind, aber auch die Kantone fordern und ihnen sagen: «Achtung, psychische Gesundheit ist ein wichtiges Thema, Bewegung auch: Tut etwas, wir unterstützen euch.» Unangenehm sein können gehört dazu, das muss das BAG aushalten. Es geht im Themenbereich Gesundheitsförderung und Prävention nicht vorwärts, wenn darauf gewartet wird, was die Kantone wollen. Das ist allerdings ein Spannungsfeld, das nicht alle Bereiche gleich angehen können.
Sind über die acht Jahre Programmlaufzeit Veränderungen in der Gesellschaft festzustellen, was die Wahrnehmung und den Konsum legaler/illegaler Substanzen sowie die Wahrnehmung und die Einstellung gegenüber Ernährung und Bewegung betrifft?
Das Hauptziel der Tabakprävention ist es, dass Nichtrauchen zur Normalität wird. Diesbezüglich konnten wichtige Schritte erreicht werden, gerade im Passivrauchschutz. Viele sagen heute allerdings: «Was gibt es jetzt noch zu tun? In öffentlich zugänglichen Innenräumen darf nicht mehr geraucht werden, was wollt ihr noch mehr?» Oft hört man, dass das Thema Tabak geregelt sei. Doch das ist es überhaupt nicht. Ein Blick ins Ausland zeigt, dass die Schweiz im Vergleich sehr verraucht ist.
Alkohol wird zunehmend Thema. Negative Äusserungen zu übermässigem Alkoholkonsum werden heute ernster genommen als früher. Doch politisch sind keine Mehrheiten für mehr Einschränkungen vorhanden. Institutionelle Vorkehrungen sind schwierig, auch wenn in Genf ein nächtliches Alkoholverkaufsverbot im Detailhandel eingeführt wurde. Das Thema ist zwar präsent, der Fortschritt auf politischer Ebene lässt jedoch auf sich warten. Den Präventionsbemühungen stehen auch die Mittel der Wirtschaft für Werbung usw. gegenüber. Alkoholprävention muss sich mit starken Gegenkräften auseinandersetzen. Die Situation scheint mir vergleichbar mit jener im Bereich Tabak vor 20 bis 30 Jahren.
Insgesamt ist klar, dass es gesellschaftliche Veränderungen gibt: Sie sind teilweise durch die Programme, teilweise durch andere Faktoren bedingt. Die Stärkung der bürgerlichen Kräfte im Parlament hemmt die Präventionsbemühungen natürlich. Die neuen Strategien sind da gefordert und der politische Rückhalt dafür ist momentan gering. Da heisst es am Ball bleiben, Koalitionen bilden und kleine, aber wichtige Schritte machen!
Und wie steht die Schweiz im internationalen Vergleich da?
Bei Tabak und Rauchen – ich habe es vorhin schon angetönt – steht die Schweiz international schlecht da. Bei uns herrscht eine verhältnismässig liberale Gesetzgebung und die Ratifizierung der Tabakkonvention der WHO steht immer noch aus, obwohl diese längst vom Bundesrat unterzeichnet ist. Die Tabakprävalenz ist vergleichsweise hoch. Betrachtet man die illegalen Drogen, ist die Schweiz ganz sicher sehr pionierhaft gewesen. Heute scheint sie diese Position etwas verloren zu haben. In den Bereichen Bewegung und Ernährung ist die Schweiz gut positioniert. Jugend+Sport etwa ist ein wichtiges Element des organisierten Sports.
Im Bereich Alkohol, würde ich sagen, hat niemand die Lösung. Das habe ich beispielsweise mit Teilnehmenden des Masterstudiengangs «Health Science» in Luzern erfahren. In einem Referat hat sich ein kommunaler Sicherheitsverantwortlicher für ein Verbot nach einer gewissen Uhrzeit ausgesprochen: Der öffentliche Raum werde sehr belastet und die Einweisungen ins Spital stiegen drastisch an. In der anschliessenden Diskussion meinte ein Teilnehmer aus Kanada, sie hätten extrem restriktive Gesetze betreffend den Alkoholkonsum Jugendlicher. Betrunken seien die Jungen trotzdem. Eine Teilnehmerin aus Kuba wiederum meinte, bei ihnen sei Alkohol kein Tabu. Jeden Tag würde Alkohol getrunken, schon Kinder erhielten Rum, das sei völlig normal. Am Ende der Diskussion stand die Einsicht, dass übermässiger Alkoholkonsum eng mit dem Wohlstand einer Gesellschaft zu tun habe. Die meisten Menschen haben wohl nichts gegen genussvollen Alkoholkonsum, wohingegen beim Rauchen inzwischen ein grosser Konsens vorhanden ist, dass dies der Gesundheit schadet.
2017 gingen die Nationalen Präventionsprogramme in die Nationale Strategie Sucht und die NCD-Strategie über. Welche Chancen und Risiken sehen Sie in diesen substanzübergreifenden gegenüber den bisherigen substanzbezogenen Strategien?
Eine substanzübergreifende Strategie ist aus Sicht der Wissenschaft sicher richtig. Sie stellt den State of the Art dar. Die Bevölkerung muss befähigt werden, sich gesundheitsförderlich verhalten zu können. Eine substanzübergreifende Strategie entspricht auch dem Bedürfnis der Praktikerinnen und Praktiker an der Front. Dazu gehören etwa Lehrpersonen. Sie schätzen es, dass eine einzige Fachperson mit den Schülerinnen und Schülern über alle Suchtthemen redet. Auch die Kantone und ihre kantonalen Fachstellen begrüssen es, wenn eine einzige Präventionsfachperson bei der Erarbeitung von Reglementen und Verordnungen mitwirkt. Wissenschaft, Praktikerinnen und Praktiker und Kantone: Sie alle begrüssen und brauchen eine ganzheitliche Strategie.
Und nun zum Aber: Die NGOs, welche sich seit Jahren für die Prävention in einem Substanzbereich einsetzen, sind natürlich in dieser Substanz verankert. Dort haben sie ihre Legitimation, ihre Netzwerke und ihre Kompetenz. Wenn ich mich seit 20 Jahren auf allen Ebenen für Alkoholprävention einsetze und Betroffene unterstütze, dann ist es sehr schwierig, mich und meine Institution neu zu positionieren und über das Engagement für die Ziele der NCD-Strategie zu legitimieren. Man darf also nicht unterschätzen, dass mit der substanzübergreifenden Strategie auch viel aufgegeben wird, zum Beispiel die bisherigen Commitments und die Positionierung. Das muss neu aufgebaut werden und das braucht Zeit. Aber es schafft auch Chancen und Synergiepotenziale, welche sich mittel- und langfristig auszahlen werden.
Eine besondere Herausforderung ist, dass NCD als Konzept schwer greif- und kommunizierbar ist. Die negativen Folgen von Alkohol, Tabak und Drogen – das kennen die Leute. Es gibt vielleicht jemanden im eigenen Umfeld, der ein Alkoholproblem hat. Man weiss also aus eigener Erfahrung, wie belastbar solche Situationen sein können, und hat eine gewisse Sensibilität entwickelt. Was NCD bedeutet und wie wichtig eine entsprechende Strategie ist, muss für die Bevölkerung noch fassbar gemacht werden.
Kann man den Erfolg von Programmen überhaupt messen?
Den einmal definierten Erfolg von Programmen kann man relativ gut messen. Die Frage ist nur, was Erfolg ist. Wir unterscheiden zwischen Output, Outcome und Impact.
Output sind die Leistungen: Wer macht was? Macht jemand etwas Neues, jetzt, da es dieses Programm gibt? Das kann relativ gut gemessen werden, kostet auch nicht viel und wird häufig in Selbstevaluationen gemacht.
Outcome ist auf der nächsten Stufe angesiedelt, bei der Zielgruppe. Ist diese tangiert, das heisst etwa, gibt es einen Patienten, der mit einer neu entwickelten Checkliste für bestimmte Risikofaktoren beraten wurde und verändert dieser daraufhin sein Verhalten? Das ist relativ gut herauszufinden, ist methodisch aber aufwendig, weil es hierfür etwa eine Befragung braucht.
Soll jedoch der Impact gemessen werden, das heisst ein gewünschter Effekt bei der Bevölkerung wie etwa die Reduktion der Tabakprävalenz oder die Senkung des Gewichts von Jugendlichen, dann wird es schwieriger. Der Beitrag eines komplexen Präventionsprogramms zur Veränderung einer Prävalenz lässt sich in der Regel nicht zuverlässig ermitteln. Das liegt einerseits daran, dass Präventionsprogramme vielfach aus einer Kombination von Massnahmen bestehen, deren spezifische Wirkung sich kaum isolieren l.sstä Andererseits wirken zahlreiche externe Faktoren auf das Verhalten oder auf Erkrankungen der Bevölkerung ein, was die Evaluation des Effekts eines Programms natürlich erschwert, wenn nicht gar verunmöglicht. Selbstverständlich müssen die entsprechenden Indikatoren beobachtet werden, ein Suchtmonitoring erstellt werden usw. Aber die Verbindung zwischen einem politischen Programm und der Entwicklung der Monitoringdaten ist am Ende nicht zuverlässig herzustellen. Das muss aber nicht unbedingt ein Problem darstellen, denn gehen Output und Outcome bei der Zielgruppe in die gewünschte Richtung und zeigt auch das Monitoring in die gewünschte Richtung, dann kann vermutet werden, dass das Programm zum Erfolg beiträgt.
Warum braucht es Wirkungsmodelle?
Wirkungsmodelle sind Veranschaulichungen der Wirkungslogik eines Programms. Sie tragen dazu bei, dass die Beteiligten ein gemeinsames Verständnis davon haben, was sie womit erreichen wollen. In der Prävention sind die Leute oft so intensiv mit ihrem Alltagsgeschäft beschäftigt, dass sie das grosse Ganze aus den Augen verlieren. Sich zu fragen, was trage ich mit meinem Projekt, zum Beispiel Ernährungsempfehlungen in Kinderspielgruppen, zum Gesamtprogramm bei, ist sehr wichtig. So sehen die Beteiligten, dass unter anderem ihre Tätigkeit dazu führt, das Gewicht bei den Kindern zu reduzieren. Das Wirkungsmodell, in dem nach den Leistungen und den Wirkungen in der Zielgruppe beziehungsweise den Wirkungen in der Gesellschaft unterschieden wird, ist also ein wichtiges Hilfsmittel zur Visualisierung und Einbettung von Aktivitäten in einen komplexen Zusammenhang.
Gute Wirkungsmodelle entstehen dann, wenn die Beteiligten sie gemeinsam erstellen und dies als einen Prozess betrachten. Oft tragen Wirkungsmodelle dazu bei, Wichtiges von weniger Wichtigem zu unterscheiden und Aktivitätsschwerpunkte zu setzen. Ein Wirkungsmodell ist bei guter Visualisierung auch wertvoll für die Kommunikation, sei es für Kampagnen, für die politische Kommunikation oder für die Präsentation von Programmen oder Strategien bei Kantonen. Daher darf ein Wirkungsmodell nicht kompliziert sein. Und nicht zuletzt ist ein gutes Wirkungsmodell wichtig, um aufzuzeigen, wer welche Rolle einnimmt. Dass etwa die Beteiligten des BAG wissen, sie sind für die Grundlagen zuständig, für anderes hingegen nicht. Eine klare Rollenzuweisung wirkt entlastend für alle Beteiligten.
Die Ziele, die Präventionsprogramme erreichen wollen, hängen immer auch von der Mehrheitsfähigkeit bei Partnern und am Ende von der Politik ab. Wie geht man mit diesem Spannungsfeld bei der Zielsetzung um?
Es heisst vor allen Dingen, dass realistische Ziele gesetzt werden müssen. Gleichzeitig sollten die Ziele aber auch eine gewisse Herausforderung beinhalten. Ziele müssen zwischen den verschiedenen Akteuren verhandelt werden, bevor sie gesetzt werden. Es ist auch zulässig, die Ziele im Rahmen regelmässiger Selbstevaluationen zu revidieren. Fachleute für Strategieentwicklung und Evaluation können in diesem Prozess beratend zur Seite stehen. Meist müssen wir dabei sagen: «Die Ziele sind zu anspruchsvoll, das ist nicht realistisch.» Bei einem Vierjahresprogramm muss ich als Evaluator am Ende des zweiten Jahres eine Messung vornehmen, damit ich im dritten Jahr die Ergebnisse habe. Dann müssen bereits Entscheide über die Weiterführung gefällt werden. Evaluiert wird also oft früh. Dabei gilt es zu beachten, dass es gut ein Jahr dauern kann, bis ein Programm anläuft. Da muss man bei der Zielsetzung bescheiden bleiben. Des Weiteren müssen Ziele messbar sein. Da Evaluationen eher aufwendig sind, sollte man sich bereits beim Setzen von Zielen fragen, was für Daten bestehen und genutzt werden können und welche zwingend neu erhoben werden müssen. Bei Indikatoren zu Wirkungen in der Gesellschaft greift man meist auf bestehende Erhebungen zurück, im Gesundheitsbereich etwa auf die Schweizerische Gesundheitsbefragung oder auf das Suchtmonitoring.
Eine gute Zusammenarbeit zwischen dem BAG und den Partnern ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für Programme. Wie beurteilen Sie die Rollenausgestaltung? Haben Sie Empfehlungen?
Ein Erfolgsfaktor wird in der NCD-Strategie bereits umgesetzt. Und der lautet: Kooperationen mit Kantonen, Berufsverbänden, NGOs, der Wirtschaft und allen anderen relevanten Akteurinnen und Akteuren suchen, sodass zusammen etwas entwickelt und vorangebracht werden kann. Die Herausforderung liegt im Spannungsfeld zwischen politischem Auftrag an das BAG, sich für die Gesundheit der Bevölkerung einzusetzen und in diesem Zusammenhang auch Probleme, wie psychische Krankheiten, gesundheitliche Auswirkungen von Vereinsamung im Alter usw. vorauszusehen und präventiv anzugehen. Und auf der anderen Seite steht die Politik, die sagt: «Lasst die Leute doch in Ruhe und hört auf mit den guten Ratschlägen. Die Freiheit steht im Zentrum.» Diese Spannung auszuhalten, ist eine grosse Herausforderung für die öffentliche Hand.
Unser Gesprächspartner
Andreas Balthasar ist Titularprofessor für Politikwissenschaft, Schwerpunkt Gesundheitspolitik, an der Universität Luzern. 1991 gründete er Interface Politikstudien Forschung Beratung in Luzern. Er wirkt hauptsächlich als Evaluations- und Strategieberater verschiedener Bundesämter. Weiter bilden die Forschung in der Sozial- und Gesundheitspolitik und die Leitung komplexer Evaluationen Schwerpunkte seiner Tätigkeit. Andreas Balthasar lebt mit seiner Familie in Luzern.